JA
Hubert Aiwanger (Freie Wähler), bayerischer Wirtschaftsminister
 Ich stehe ganz klar hinter einer Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung. Wir stehen in der Verantwortung, die Konjunktur weiterhin gezielt zu stützen, und dazu müssen wir ebenfalls für positive Kaufimpulse sorgen. Es ist richtig und gut, dass sich die wirtschaftliche Lage in Bayern insgesamt kontinuierlich verbessert. Vollständig überm Berg sind wir aber noch nicht. Ein Auslaufen der Umsatzsteuersenkung zum Jahresende wäre daher mehr als unangebracht und die falsche politische Botschaft, dass der Normalzustand wiederhergestellt wäre.
Ich stehe ganz klar hinter einer Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung. Wir stehen in der Verantwortung, die Konjunktur weiterhin gezielt zu stützen, und dazu müssen wir ebenfalls für positive Kaufimpulse sorgen. Es ist richtig und gut, dass sich die wirtschaftliche Lage in Bayern insgesamt kontinuierlich verbessert. Vollständig überm Berg sind wir aber noch nicht. Ein Auslaufen der Umsatzsteuersenkung zum Jahresende wäre daher mehr als unangebracht und die falsche politische Botschaft, dass der Normalzustand wiederhergestellt wäre.
Wir dürfen nicht vergessen: Die Umsatzsteuersenkung zum 1. Juli 2020 war für die Betriebe mit viel Bürokratie und Umstellungskosten verbunden. In der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Lage sorgte das für einigen Unmut. Ich will den Unternehmerinnen und Unternehmern dieselben Kosten und Anstrengungen nach nur sechs Monaten nicht noch einmal zumuten. Die Betriebe haben derzeit an vielen Fronten zu kämpfen. Wir müssen also alles vermeiden, was sie ohne Not zusätzlich belastet.
Ich bin überzeugt: Die Umsatzsteuersenkung sollte mindestens bis Ende 2021 verlängert werden. Erst dann dürfen wir mit einer Stabilisierung der Konjunktur rechnen. Natürlich bedeutet eine Verlängerung erhebliche Steuermindereinnahmen. Die Alternative ist aber deutlich teurer: fehlende Umsätze, Betriebe, die dichtmachen und Arbeitsplätze abbauen. Wir müssen jetzt investieren, jetzt an die Zukunft denken und in der Krise der arg in Mitleidenschaft gezogenen Wirtschaft eine Perspektive bieten.
Eine ähnliche Situation haben wir in der Gastronomie: Hier muss der bis 30. Juni 2021 befristete ermäßigte Umsatzsteuersatz dauerhaft gelten und auch Getränke einbeziehen. Es wäre ein Schildbürgerstreich, ihn wieder anzuheben. Ein dauerhaft ermäßigter Umsatzsteuersatz ist wenigstens ein kleiner Lichtblick in sehr schweren Zeiten. Das ist ein Beitrag zur Sozialkultur. Ansonsten riskieren wir ein Betriebssterben.
NEIN
Oliver Holtemöller, Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle
 Die Große Koalition möchte mit der befristeten Mehrwertsteuersenkung die Konsumnachfrage stärken. Der Hauptgrund für die Konsumzurückhaltung liegt darin, dass nach wie vor viele Aktivitäten nicht im gewohnten Umfang möglich sind. In Restaurants, Hotels und Konzerthallen passen unter Beachtung der Hygieneregeln einfach weniger Menschen. Die Haushalte reagieren auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und auf die individuellen Risiken mit einer erhöhten Ersparnisbildung und mit Umschichtungen hin zum Online-Handel. Die Einkommen der privaten Haushalte sind gesamtwirtschaftlich hingegen nicht das Problem, weil diese dank staatlicher Transfers in der Summe auch in diesem Jahr weitgehend stabil bleiben.
Die Große Koalition möchte mit der befristeten Mehrwertsteuersenkung die Konsumnachfrage stärken. Der Hauptgrund für die Konsumzurückhaltung liegt darin, dass nach wie vor viele Aktivitäten nicht im gewohnten Umfang möglich sind. In Restaurants, Hotels und Konzerthallen passen unter Beachtung der Hygieneregeln einfach weniger Menschen. Die Haushalte reagieren auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und auf die individuellen Risiken mit einer erhöhten Ersparnisbildung und mit Umschichtungen hin zum Online-Handel. Die Einkommen der privaten Haushalte sind gesamtwirtschaftlich hingegen nicht das Problem, weil diese dank staatlicher Transfers in der Summe auch in diesem Jahr weitgehend stabil bleiben.
Das volkswirtschaftliche Einkommen sinkt jedoch aufgrund nicht stattfindender und auch nicht mehr nachzuholender Aktivitäten erheblich. Diese Einbußen sind real und können durch die Wirtschaftspolitik gesamtwirtschaftlich kaum kompensiert werden. Die Wirtschaftspolitik kann aber umverteilen – idealerweise von denjenigen, die auch in der Krise stabile Einkommen haben, hin zu denjenigen, die Einkommenseinbußen haben.
Von der Mehrwertsteuersenkung profitieren aber vor allem Menschen, deren Einkommen gegenwärtig nicht gefährdet sind und die sich auch in der aktuellen Krise die Anschaffung langlebiger Konsumgüter leisten können. Und in dem Umfang, in dem die Mehrwertsteuersenkung tatsächlich die Binnennachfrage anregt, wird die Mehrnachfrage vor allem in diejenigen Bereiche fließen, in denen es ohnehin wenig Beeinträchtigungen gibt. Die Mehrwertsteuersenkung vergrößert also tendenziell den realen Einkommenskeil zwischen den von der Epidemie Betroffenen und den einkommensmäßig nicht Betroffenen. Wenn der gesamte Kuchen kleiner wird und trotzdem einige größere Stücke davon bekommen, bleibt für die anderen noch weniger übrig. Die Politik muss abwägen, ob die intendierten vagen Vorzieheffekte bei langlebigen Konsumgütern diese Verteilungsprobleme aufwiegen.










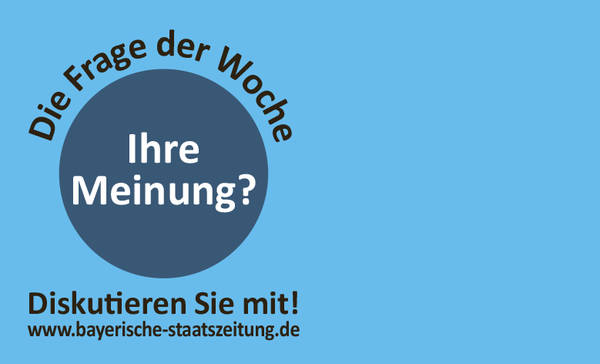
 Ich stehe ganz klar hinter einer Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung. Wir stehen in der Verantwortung, die Konjunktur weiterhin gezielt zu stützen, und dazu müssen wir ebenfalls für positive Kaufimpulse sorgen. Es ist richtig und gut, dass sich die wirtschaftliche Lage in Bayern insgesamt kontinuierlich verbessert. Vollständig überm Berg sind wir aber noch nicht. Ein Auslaufen der Umsatzsteuersenkung zum Jahresende wäre daher mehr als unangebracht und die falsche politische Botschaft, dass der Normalzustand wiederhergestellt wäre.
Ich stehe ganz klar hinter einer Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung. Wir stehen in der Verantwortung, die Konjunktur weiterhin gezielt zu stützen, und dazu müssen wir ebenfalls für positive Kaufimpulse sorgen. Es ist richtig und gut, dass sich die wirtschaftliche Lage in Bayern insgesamt kontinuierlich verbessert. Vollständig überm Berg sind wir aber noch nicht. Ein Auslaufen der Umsatzsteuersenkung zum Jahresende wäre daher mehr als unangebracht und die falsche politische Botschaft, dass der Normalzustand wiederhergestellt wäre. Die Große Koalition möchte mit der befristeten Mehrwertsteuersenkung die Konsumnachfrage stärken. Der Hauptgrund für die Konsumzurückhaltung liegt darin, dass nach wie vor viele Aktivitäten nicht im gewohnten Umfang möglich sind. In Restaurants, Hotels und Konzerthallen passen unter Beachtung der Hygieneregeln einfach weniger Menschen. Die Haushalte reagieren auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und auf die individuellen Risiken mit einer erhöhten Ersparnisbildung und mit Umschichtungen hin zum Online-Handel. Die Einkommen der privaten Haushalte sind gesamtwirtschaftlich hingegen nicht das Problem, weil diese dank staatlicher Transfers in der Summe auch in diesem Jahr weitgehend stabil bleiben.
Die Große Koalition möchte mit der befristeten Mehrwertsteuersenkung die Konsumnachfrage stärken. Der Hauptgrund für die Konsumzurückhaltung liegt darin, dass nach wie vor viele Aktivitäten nicht im gewohnten Umfang möglich sind. In Restaurants, Hotels und Konzerthallen passen unter Beachtung der Hygieneregeln einfach weniger Menschen. Die Haushalte reagieren auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und auf die individuellen Risiken mit einer erhöhten Ersparnisbildung und mit Umschichtungen hin zum Online-Handel. Die Einkommen der privaten Haushalte sind gesamtwirtschaftlich hingegen nicht das Problem, weil diese dank staatlicher Transfers in der Summe auch in diesem Jahr weitgehend stabil bleiben.




Kommentare (53)