Als erstes Bundesland hat Bayern zum 1. September die Wohnsitzauflage für Flüchtlinge eingeführt. Damit können Behörden anerkannten Asylbewerbern für drei Jahre den Wohnort vorschreiben. Ausgenommen sind Menschen, die bereits eine sozialversicherungspflichtige Arbeit oder eine Ausbildungsstelle haben. Damit will die CSU Ghettos verhindern. Vieles ist derzeit aber noch unklar.
Das Thema Wohnsitzauflage für Flüchtlinge ist keines, das bei Christian Meißner (CSU), Landrat im Kreis Lichtenfels, bisher für Begeisterung sorgt. „In der Theorie ist uns klar, was zu tun ist“, sagt er. „Aber wie wir diese rechtliche Regelung praktisch umsetzen sollen, das ist vollkommen offen.“ Dass die Wohnsitzauflage allerdings zu absurden Situationen führen kann, diese Erfahrung musste Meißner bereits machen.
Es geht dabei um den Fall eines Flüchtlings, der im Mai in Lichtenfels seine Anerkennung bekam, dann aber noch Nordrhein-Westfalen weitergezogen ist. Dort hatte sich der Flüchtling ordnungsgemäß beim Job-Center gemeldet. Ob der Flüchtling auch eine eigene Wohnung gefunden hatte, weiß Meißner nicht. Aber er weiß, dass NRW nicht mehr gewillt war, für den Flüchtling die Sozialleistungen zu bezahlen. Also musste der Mann nach Lichtenfels zurück. „Jetzt lebt er“ sagt Meißner, „wieder in der Sammelunterkunft, aus die er im Mai ausgezogen war.“ Eine passende Wohnung für ihn im Landkreis habe man bisher nicht gefunden.
Im Landkreis Neu-Ulm drohten bereits Ghettobildungen
Das neue Integrationsgesetz macht es möglich. Die dort festgeschriebene Wohnsitzauflage bedeutet auch, dass Flüchtlinge, die Sozialleistungen empfangen, in das Bundesland zurückgeschickt werden können, in dem sie ihre Anerkennung bekamen. Das Gesetz trat Anfang August in Kraft, gilt aber rückwirkend ab dem 1. Januar 2016. Als erstes Bundesland hat Bayern die Auflage des Bundes umgesetzt. Seit dem 1. September kann der Freistaat Flüchtlingen für die ersten drei Jahre nach ihrer Anerkennung den Wohnort vorschreiben.
Mit der Regelung sollen Ghetto-Bildungen verhindert und Ballungsräume entlastet werden. „Mit der Wohnsitzzuweisung gewährleisten wir, dass Migrantinnen und Migranten in Bayern mit uns leben und nicht neben uns. So verhindern wir die Bildung von Parallelgesellschaften und fördern zugleich die Integration bayernweit. Denn Bayern ist überall lebenswert“, erklärte Bayerns Sozialministerin Emilia Müller.
Verantwortlich für die Durchführung der Zuweisung sind die Bezirksregierungen. Doch wie sich ihre neue Zuständigkeit gestaltet, wissen die Regierungen noch nicht. Und auch vieles andere ist noch unklar.
Die Staatszeitung hat alle sieben bayerischen Bezirksregierungen nach ihren bisherigen Maßnahmen, nach dem geschätzten Aufwand und nach dem Durchführungs-Procedere befragt. Eine Sprecherin der Regierung von Oberfranken erklärte: „Die Wohnsitzzuweisung ist gerade erst in Kraft getreten. Sie ist die erste ihrer Art und hat dementsprechend Modellcharakter. Es gilt, die ersten Erfahrungen mit der Wohnsitzzuweisung abzuwarten.“ Ähnlich äußerte sich auch ein Sprecher der Regierung von Unterfranken. Es gebe für die Durchführung noch keine bundesweiten Vorbilder. Bisherige Verwaltungsverfahren lägen damit noch nicht vor.
Rutschen mehr Menschen in die staatliche Versorgung?
Alle anderen fünf Bezirksregierungen haben „der Zuständigkeit halber“ direkt an das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales verwiesen. Hier bat man um Verständnis. „Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine detaillierten Auskünfte erteilt werden“, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die Zahl der Betroffenen beispielsweise hänge von vielen Faktoren ab, weshalb eine Prognose sehr schwierig sei.
Ausgenommen von der Wohnsitzzuweisung sind Flüchtlinge, die eine Ausbildung begonnen haben oder eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit mit einem Durchschnittsverdienst von mindestens 712 Euro nachweisen können. Auch eine Härtefall-Regelung gibt es. Für die Bezirksregierungen bedeutet das: Jeder Einzelfall muss überprüft werden. Um diesen bürokratischen Aufwand zu schaffen, haben die Regierungen Dutzende von Stellen ausgeschrieben. Besetzt sind die Stellen in der Mehrzahl noch nicht.
Der Lichtenfelser Landrat Meißner ist sich sicher, dass der Verwaltungsaufwand für seine Mitarbeiter stark zunehmen wird. „Und ich bin mir sicher“, sagt er, „dass wir schon im Bereich der Wohnungssuche auf große Hindernisse stoßen werden. Bezahlbarer Wohnraum, wie wir ihn für Flüchtlinge und andere Aufenthaltsberechtigte benötigen, wächst schließlich nicht auf Bäumen.“ Und nur mit der Wohnung sei es nicht getan. Auch die Infrastruktur müsse stimmen, vom Deutschkurs bis zum Job-Angebot, damit Integration gelinge könne. „Die Wohnungszuweisung“, auch davon ist Meißner überzeugt, „wird mir und meinen Mitarbeitern einige graue Haare bescheren.“
Optimistischer bewertet ein Kollege Meißners am anderen Ende von Bayern die neue Rechtslage. „Ich hoffe, dass die Verordnung dabei hilft, Lasten und Pflichten der Integration gleichmäßiger zu verteilen“, sagt Thorsten Freudenberger. Der CSU-Politiker nennt ein Beispiel aus seinem Landkreis Neu-Ulm. „In der Stadt Neu-Ulm, in dem ein Drittel der Bevölkerung wohnt, waren zeitweise die Hälfte der Flüchtlinge untergebracht. Das kann auf Dauer nicht gut gehen.“
Vor allem Hilfsorganisationen haben die Rechtsverordnung scharf kritisiert. Die Integration werde durch die Wohnsitzauflage massiv erschwert, sagt Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhard. „Wir gehen davon aus, dass dadurch am Ende mehr Menschen in die staatliche Versorgung rutschen.“ Von „Diskriminierung“ spricht Johanna Böhm vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Wenn Integration aktiv verhindert werden soll, dann sind Sonderregeln, Zwang und Verbote genau das richtige Mittel.“
Der Flüchtlingsrat, berichtet Böhm, habe in den vergangenen Tagen von mehreren Fällen erfahren, in denen hiesige Ausländerbehörden ohne Rücksicht auf bereits angemietete Wohnungen, bezahlte Kautionen, Anmeldungen in Kursen oder Schulen einen Umzug im letzten Moment verhinderten oder Personen aufforderten, wieder zurückzukommen.
Auch Freudenberger kennt aus seinem Landkreis so einen Fall. Ein Flüchtling hatte in einem Nachbarort, der in Baden-Württemberg liegt, eine Wohnung gefunden. In diese durfte er aufgrund der neuen Gesetzeslage jedoch nicht einziehen. „Wir müssen sehen, wie wir diesen Fall lösen“, sagt der Landrat. „Es gibt kein Gesetz, das es jedem recht machen kann. Aber wir werden immer unser Bestes versuchen.“
Wenige Tage nach Bayern hat auch Baden-Württemberg die Wohnsitzauflage umgesetzt, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt wollen demnächst folgen. Gegen die Auflage hat sich bisher nur Rheinland-Pfalz ausgesprochen. Die Beratungen in den anderen Bundesländern dauern noch an. (Beatrice Oßberger)










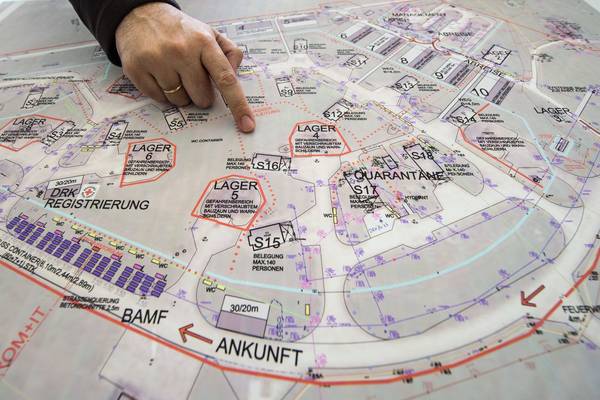





Kommentare (0)
Es sind noch keine Kommentare vorhanden!