Deutschland um 1900. Nachdem der öffentliche Raum durch Gaslaternen erleuchtet worden war, revolutionierte kurze Zeit später erneut eine Energieform die Gesellschaft: Die erste große Elektrizitätsausstellung in Paris 1881 mit Beleuchtungsspektakeln und der ersten elektrischen Straßenbahn faszinierte die Menschen. Es folgten Ausstellungen in München 1882, Wien 1883 und Frankfurt am Main 1891. Man wollte Begeisterung für die neue Energieform wecken und anregen, sie in den Alltag zu integrieren.  Das elektrische Licht machte dabei den Anfang. Als klassische Werbefigur fungierte einerseits der antike Prometheus, der laut Mythologie mit seiner „guten Tat“ den Menschen das Feuer – hier nun stellvertretend das elektrische Licht – gegen den Willen der Götter persönlich überbrachte, andererseits die Fée électricité. Bereits Ludwig Kandler stellte sie 1883 grafisch dar. Noch prominenter wurde sie durch das monumentale Wandgemälde La Fée électricité des französischen Künstlers Raoul Dufy, der es im Auftrag der Pariser Elektrizitätswerke für den Pavillon der Elektrizität für die Pariser Weltausstellung 1937 entwarf und ausführte: Die Fée électricité war als erfolgreiche Werbefigur etabliert. Hinsichtlich des nach wie vor insbesondere von der Kirche geprägten, vorherrschenden Geschlechterrollenbilds scheint es gerade mit Blick auf Kandlers provokante Darstellung auf den ersten Blick erstaunlich, dass ausgerechnet eine Frau als Werbefigur so zugkräftig in Szene gesetzt wurde.
Das elektrische Licht machte dabei den Anfang. Als klassische Werbefigur fungierte einerseits der antike Prometheus, der laut Mythologie mit seiner „guten Tat“ den Menschen das Feuer – hier nun stellvertretend das elektrische Licht – gegen den Willen der Götter persönlich überbrachte, andererseits die Fée électricité. Bereits Ludwig Kandler stellte sie 1883 grafisch dar. Noch prominenter wurde sie durch das monumentale Wandgemälde La Fée électricité des französischen Künstlers Raoul Dufy, der es im Auftrag der Pariser Elektrizitätswerke für den Pavillon der Elektrizität für die Pariser Weltausstellung 1937 entwarf und ausführte: Die Fée électricité war als erfolgreiche Werbefigur etabliert. Hinsichtlich des nach wie vor insbesondere von der Kirche geprägten, vorherrschenden Geschlechterrollenbilds scheint es gerade mit Blick auf Kandlers provokante Darstellung auf den ersten Blick erstaunlich, dass ausgerechnet eine Frau als Werbefigur so zugkräftig in Szene gesetzt wurde.
Die Elektrizität stand dabei für einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Umbruch: Im Fokus stand der Umstieg von der Kohle und vom gefährlichen Gas hin zur buchstäblich sauberen, sicheren und scheinbar unendlich vorhandenen Elektrizität – sie verhieß ein Allheilmittel gegen alle Probleme der industrialisierten Zivilisation zu werden. Frankfurts Oberbürgermeister Franz Adickes war bei der Eröffnung der dortigen Ausstellung 1891 überzeugt, dass „es gelingt, einen Theil der Sünde, welche das Zeitalter des Dampfes an der Menschheit verschuldet hat, im Zeitalter der Elektricität wieder gut zu machen, […] wenn wir dem Einzelnen in sein Haus und seine Werkstätte die theilbare Kraft hineinleiten […].“ Stromkraftwerke waren jedoch bereits damals teure Investitionen, die sich amortisieren mussten: Wer also besaß noch kein elektrisches Bügeleisen, keinen elektrischen Eierkocher? Den Damen wurde ein elektrischer Staubsauger wärmstens empfohlen, den Herren der elektrische Zigarrenanzünder.
Zwei Studienseminare an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) und der Paris Lodron Universität Salzburg (PLUS) beschäftigten sich in den Wintersemestern 2021/22 und 2022/23 mit verschiedenen Facetten der Elektrifizierung des Alltags um 1900. In diesem ersten Teil (die Fortsetzung lesen Sie in der Ausgabe September/Oktober von Unser Bayern) geht es um die Vermittlung neuer Energieformen im Kontext gesellschaftlich verankerter Geschlechter- und Energiediskurse. Der Fokus liegt dabei auf den ersten großen deutschen Ausstellungen in München sowie Frankfurt am Main und auf der Elektrifizierung des Haushalts. (Lina Schröder)
Innovatives Forschungsprojekt
Aktuelle Auseinandersetzungen rund um die Energiwende führten in den Studienseminaren an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) und an der Paris Lodron Universität Salzburg (PLUS) zu Diskussionen bezüglich der Vergleichbarkeit damaliger und heutiger Diskurse; Hausarbeiten setzten sich intensiv mit dem Thema auseinander. Die Ergebnisse beider Kurse werden in einem Sammelband zusammengeführt, unterstützt von Dieter Schott (TU Darmstadt) und Martin Knoll (PLUS). Der Publikation ging im Februar 2024 ein gemeinsamer, zweitägiger, internationaler Workshop in Salzburg voraus und führte die Studierenden mit etablierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter anderem aus München, Bamberg und Manchester zusammen. Es wurde ein Podcast mit allen Teilnehmern produziert. Der Tagungsbericht, verfasst von Anna-Katharina Wiesinger, kann auf der Plattform H-Soz-Kult nachgelesen werden
(meinclio.clio-online.de/open/pdf/conferencereport/fdkn-143853).
Das Studienprojekt steht für innovatives geschichtswissenschaftliches Forschen – zum Thema Elektrifizierung besteht seitens der Geschichtswissenschaft noch Forschungsbedarf. Zudem zeigt das Projekt den Kosmos „Universität“ von einer anderen Seite: Hier laufen Studierende nicht nur mechanisch den Credits, Dozierende nicht nur den Drittmitteln hinterher. Stattdessen forschen beide Seiten gemeinsam an einem sie interessierenden Thema – das ist Bildung im klassischen Humboldt'schen Ideal. Workshop und Sammelband erfahren Sponsoring von zahlreichen Institutionen als Zeichen für das Interesse am Thema ebenso wie für die Wertschätzung des Projekts: Neben einer großzügigen Förderung der Universität Salzburg (Fachbereich Geschichte sowie Studienvertretung STV/ÖH) wird das Studienprojekt unterstützt durch die Stadt Salzburg, den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Gesellschaft für Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung e.V. (GSU), die Gesellschaft für Technikgeschichte e.V. (GTG), das österreichische Kraftwerk Glatzing-Rüstorf eGen (KWG), die Salzburger Firma Kaupa Stingeder Montageservice OG sowie durch das österreichische Verkehrsunternehmen Stern & Hafferl und die Sparkassenstiftung Würzburg. Die Einwerbung dieser Drittmittel war ein von Studierenden und Dozierenden gemeinsam gestalteter Prozess.
Im Sinn des Studienprojekts wurden auch die Artikel für Unser Bayern gemeinsam von Studierenden und Lehrenden verfasst. (LS)
München, 1882
Eine besondere Eigenheit im Prozess der frühen Elektrifizierung waren die Elektrizitätsausstellungen, die bis Ende des 19. Jahrhunderts stattfanden. Diese waren mehr als reine Fachmessen. Auf ihnen wurde Technik auf eine lebensweltnahe Art und Weise präsentiert, für viele Besucherinnen und Besucher boten sie überhaupt einen ersten Berührungspunkt mit noch fremden Innovationen. Die Bedeutung dieser Inszenierungen darf nicht unterschätzt werden. Gerade für die Durchsetzung technischer Neuerungen im öffentlichen Raum ist es wichtig, sie über öffentliche Diskussionen in die Vorstellungswelt der Menschen zu bringen. Für die frühe Elektrifizierung spielte dabei das elektrische Licht eine besondere Rolle. Seine optischen Eigenheiten und die Ähnlichkeiten zum bereits bestehenden Gaslicht machten es für eine breite Masse relevant.
In Deutschland fand die erste Elektrizitätsausstellung 1882 im Münchner Glaspalast statt. Auch dort spielte elektrisches Licht eine wichtige Rolle. Man wollte seine Anwendung in verschiedenen Bereichen demonstrieren. Bewusst wurde die Konfrontation mit dem etablierten Gaslicht gesucht: Für dieses wurden kaum neue Anwendungsmöglichkeiten präsentiert, vielmehr sollte sich zeigen, dass das elektrische Licht generell die bessere Wahl wäre. Die rege öffentliche Berichterstattung griff das Thema und die Bedeutungen der verschiedenen Lichtformen auf.
Beispielhaft war ein vollkommen elektrisch beleuchtetes Theater im Rahmen der Münchner Exposition zu bestaunen. Gerade das Theater stand zu 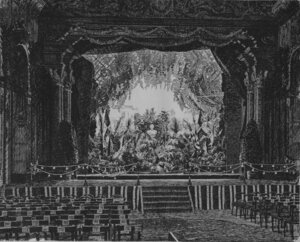 Beginn der Konkurrenz zwischen Gas und Elektrizität besonders im Fokus. Licht im Theater hatte sowohl zur Beleuchtung des Publikumsraums als auch zur Inszenierung des Bühnengeschehens eine lange Tradition. Das vorherrschende Gaslicht stand schon vor der Möglichkeit der Elektrifizierung in der Kritik: Schlechte Luft, Hitze, Verschmutzung der Räume und ihres oft wertvollen künstlerischen Schmucks, vor allem die Gefahr (Explosion), die von der
Beginn der Konkurrenz zwischen Gas und Elektrizität besonders im Fokus. Licht im Theater hatte sowohl zur Beleuchtung des Publikumsraums als auch zur Inszenierung des Bühnengeschehens eine lange Tradition. Das vorherrschende Gaslicht stand schon vor der Möglichkeit der Elektrifizierung in der Kritik: Schlechte Luft, Hitze, Verschmutzung der Räume und ihres oft wertvollen künstlerischen Schmucks, vor allem die Gefahr (Explosion), die von der  Anwendung des Gases ausging, wurden bemängelt. Seit dem Brand des Wiener Ringtheaters infolge einer Gasexplosion mit mehreren Hundert Toten war zum Zeitpunkt der Ausstellung erst ein Jahr vergangen; die Tragödie war in den Köpfen noch präsent. Aus diesem Grund wurde mit Spannung auf den Versuch eines komplett elektrisch beleuchteten Theaters geblickt. Dass Karl Freiherr von Perfall, der Generalintendant des königlichen Theaters, als Mitglied des Ausstellungskomitees an der Präsentation unmittelbar beteiligt war, zeigt, dass die Theaterbranche Hoffnungen in das elektrische Licht setzte. Vor allem galt es zu zeigen, wie es den Anforderungen der Bühnenbeleuchtung angepasst werden konnte.
Anwendung des Gases ausging, wurden bemängelt. Seit dem Brand des Wiener Ringtheaters infolge einer Gasexplosion mit mehreren Hundert Toten war zum Zeitpunkt der Ausstellung erst ein Jahr vergangen; die Tragödie war in den Köpfen noch präsent. Aus diesem Grund wurde mit Spannung auf den Versuch eines komplett elektrisch beleuchteten Theaters geblickt. Dass Karl Freiherr von Perfall, der Generalintendant des königlichen Theaters, als Mitglied des Ausstellungskomitees an der Präsentation unmittelbar beteiligt war, zeigt, dass die Theaterbranche Hoffnungen in das elektrische Licht setzte. Vor allem galt es zu zeigen, wie es den Anforderungen der Bühnenbeleuchtung angepasst werden konnte.
Die Resonanz der Öffentlichkeit war durchweg positiv. Stolz wurde darauf verwiesen, dass auch in Berlin anerkennend über diese Versuche im Theater gesprochen wurde – eine lokalpatriotische Konnotation, konkurrierten München und Berlin doch um die Vorherrschaft als führende Kunstmetropole. Vor allem aber, so wurde gewürdigt, erfülle die Beleuchtung alle Anforderungen des Gaslichts ohne dessen Nachteile. Betont wurde auch die zunehmende Hygiene, die ohne das verschmutzende Gaslicht geboten werden könne. Die Münchner Neuesten Nachrichten erklärten das Theater zu einem Hauptanziehungspunkt der gesamten Ausstellung. Parallel hatte eine Versammlung deutscher Theaterintendanten stattgefunden – deren Bewertung war aussichtsreich.
Das Ausstellungsspektakel hatte direkte Auswirkungen auf die fortschreitende Elektrifizierung Münchens. Es folgten Versuche im Residenztheater, wo die Technologie, die zuvor im Glaspalast demonstriert worden war, angewandt wurde. Dieses Theater wurde kurze Zeit später das erste Theater Deutschlands mit einer komplett elektrischen Beleuchtung: ein Prestigeprojekt als Vorreiter für die Elektrifizierung bald des Hoftheaters und weiterer Münchner Gebäude. (Hannah Walter)
Frankfurt am Main, 1891
Über eine Million Menschen strömten zwischen Mai und Oktober 1891 auf das ehemalige Frankfurter Bahnhofsgelände. Sie besuchten die Internationale Elektrotechnische Ausstellung – ein Großprojekt der Elektrotechnischen Gesellschaft –, schauten sich fasziniert die technischen Ausstellungsstücke an, lauschten der telefonischen Übertragung von Opernaufführungen und fuhren mit elektrisch betriebenen Straßenbahnen und Fesselballons über das Ausstellungsgelände.  Die Schau war eine große Werbeplattform für die Elektrotechnik und weit mehr als eine bloße Präsentation moderner Technologie: Sie war Teil einer grundlegenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung über die Zukunft der Energieversorgung und die Gestaltung einer modernen, lebenswerten Stadt.
Die Schau war eine große Werbeplattform für die Elektrotechnik und weit mehr als eine bloße Präsentation moderner Technologie: Sie war Teil einer grundlegenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung über die Zukunft der Energieversorgung und die Gestaltung einer modernen, lebenswerten Stadt.
Frankfurt war lange Zeit ambivalent gegenüber industriellen Entwicklungen, die das 19. Jahrhundert geprägt hatten. Schmutz, Lärm, soziale Verelendung: Die gesellschaftlichen Probleme, die mit der Industrialisierung  und dem anhaltenden Städtewachstum einhergingen, waren Ende des 19. Jahrhunderts deutlich sichtbar. Vor allem in Frankfurt, das aufgrund seiner Geschichte stark auf bürgerliche Werte und Autonomie orientiert war, blickten viele Bewohner skeptisch auf die Veränderungen. Man sah die sozialen Probleme, die Bedrohung des Handwerks durch die Fabriken, und befürchtete, dass die Schlote, der Lärm und der Ruß die Schönheit der Stadt gefährden würden. Gleichzeitig sorgte sich die Stadt – die sich jahrzehntelang gegen die Gewerbefreiheit gestellt hatte, um das lokale Handwerk zu schützen – darum, den Anschluss an die wirtschaftliche Entwicklung anderer Städte zu verlieren.
und dem anhaltenden Städtewachstum einhergingen, waren Ende des 19. Jahrhunderts deutlich sichtbar. Vor allem in Frankfurt, das aufgrund seiner Geschichte stark auf bürgerliche Werte und Autonomie orientiert war, blickten viele Bewohner skeptisch auf die Veränderungen. Man sah die sozialen Probleme, die Bedrohung des Handwerks durch die Fabriken, und befürchtete, dass die Schlote, der Lärm und der Ruß die Schönheit der Stadt gefährden würden. Gleichzeitig sorgte sich die Stadt – die sich jahrzehntelang gegen die Gewerbefreiheit gestellt hatte, um das lokale Handwerk zu schützen – darum, den Anschluss an die wirtschaftliche Entwicklung anderer Städte zu verlieren.
Die Elektrizität erschien vor diesem Hintergrund als vielversprechende Lösung, die Probleme der Industrialisierung zu umgehen, und zwar in Einklang mit den bürgerlichen Idealen und ohne den Energiekonsum einschränken zu müssen. Im Gegensatz zur Dampfmaschine, die der Krafterzeugung diente, und dem Gas, das überwiegend für Beleuchtungszwecke verwendet wurde, versprach die Elektrizität eine Nutzung ohne Umweltbelastungen im direkten Lebensumfeld. Da sich Produktions- und Verwendungsort prinzipiell trennen ließen, hatte sie – trotz kritischer Stimmen – den Ruf einer sozialen, sauberen und gerechten Energie. Befürworter erhoben sie gar zur Befreierin der Menschheit. In den Debatten rund um die Elektrizität wurde diese neue Energieform zum Symbol für Modernität.
Die Frankfurter Ausstellung spiegelte die großen und kleinen Hoffnungen und Visionen rund um die Elektrizität. Sie symbolisierte eine neue Phase der Diskussion. Während sich in der vorangegangenen Münchner Ausstellung – nur zehn Jahre zuvor – alles um die Möglichkeiten des elektrischen Lichtes gedreht hatte, ging es in Frankfurt um die systematische Nutzung von Elektrizität. Obwohl die Nachfrage nach Elektrizität in der Bevölkerung überschaubar war, entwarf man in der Ausstellung das Bild einer vollständig elektrifizierten Stadt. Man unternahm Versuche zu zeigen, welche technische Umsetzung und Stromart am besten für den Ausbau der Elektrizitätsversorgung geeignet wären. Es waren Versuche, die dem sogenannten Frankfurter Systemstreit entsprangen – dem kommunalpolitischen Streit darum, ob ein zukünftiges E-Werk mit Gleichstrom oder Wechselstrom betrieben werden sollte.
Höhepunkt der Ausstellung waren daher die Experimente, Elektrizität über weite Strecken zu übertragen: ein wichtiger Faktor für Wünsche, E-Werke möglichst weit von den Innenstädten entfernt zu bauen und neue Energiequellen zu erschließen. Die gelungene Fernübertragung von Lauffen am Neckar auf das Ausstellungsgelände, eine Stecke von gut 170 Kilometern, galt als technischer Meilenstein und befeuerte die Euphorie rund um die Ausstellung und die Elektrizität.
In der Realität blieb die Elektrifizierung in Frankfurt jedoch hinter den hochgesteckten Erwartungen und Idealen der Frankfurter Bürgerschaft zurück. Die Fertigstellung des E-Werks im Jahr 1895 markierte das Ende des Streites zwischen Gleich- und Wechselstrom und den Beginn einer flächendeckenden Elektrizitätsversorgung – die gesellschaftlichen Herausforderungen blieben jedoch bestehen. Trotz der Bemühungen der Stadtverwaltung war der Zugang zur Elektrizität lange ungleich verteilt und konnte die sozialen Ungleichheiten nicht überwinden. Die Frankfurter Ausstellung und die Debatten in ihrem Umfeld zeigen daher, wie die Elektrizität zur Projektionsfläche gesellschaftlicher Wünsche wurde und sich damit selbst – beziehungsweise durch ihre Befürworter – zur Weiterentwicklung verhalf. Die konkreten gesellschaftlichen Probleme trafen dabei auf wirtschaftliche und politische Interessen, die die Weiterentwicklung und Verbreitung der Technik vorantrieben und formten. (Denise Nadler/Joline Jung)
Die Fée électricité und die Frauenbewegung
Elektrizität war, wie die Prometheus-Metapher zeigt, zunächst mehrheitlich eine Männerdomäne, die Männer standen deshalb im Zentrum der Bewerbung, Entwicklung und der finanziellen Abwicklung. Erst mit der zunehmenden Verbreitung von Haushaltsgeräten rückten Frauen vermehrt in den Fokus. Schon bevor 1881 in Paris die erste große internationale Weltausstellung die „Wunder der Elektrizität“ präsentierte, formierte sich seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts parallel zur Elektrifizierung die erste Frauenbewegung. Die erste ihrer Art in Wien in den 1880er-Jahren forderte eine verbesserte gesellschaftliche Stellung der Frau, welche unter anderem durch eine Neubewertung der Haushaltstätigkeiten erreicht werden sollte. Heute spricht man bei Haushaltsarbeit weitergreifend von „Care-Arbeit“ oder unbezahlter Arbeit, die zwar elementar für die Gesellschaft ist, aber nicht entsprechend entlohnt wird.
Frauen arbeiteten zum Beispiel als Wäscher-, Plätter- oder Büglerinnen, sie waren zugleich für den eigenen Haushalt und die Kindererziehung zuständig. Feministinnen forderten daher auch besser ausgestattete Wohnungen oder eine Vergesellschaftung der Hausarbeit, um Frauen zu entlasten. Mit Blick auf die zeitliche Überschneidung und den rasanten Aufstieg der Fée électricité als Werbeikone für die Haushaltsarbeit erleichternde elektrische Produkte stellt sich die Frage, ob und inwieweit die Frauenbewegung die Einführung der Elektrizität in den als typisch weiblich konnotierten Haushalt unterstützte beziehungsweise ob das in den verschiedenen Werbemaßnahmen transportierte „moderne“ Frauenbild den emanzipatorischen Zielen der Bewegung überhaupt gerecht wurde.
Der Fokus emanzipatorischer Aktivitäten lag dabei zunächst auf der Einführung gemeinschaftlicher Waschküchen, in denen der hohe Zeit- und Kraftaufwand kompensiert werden sollte. Eine weitere Idee waren die sogenannten Einküchenhäuser – ein Reformmodell städtischer Wohnbebauung, bei dem eine zentral bewirtschaftete Großküche  innerhalb eines Mehrparteienhauses die Küchen der einzelnen Wohnungen ersetzte. Teilweise wurden diese Forderungen umgesetzt, wie etwa in Form einer Zentralwaschküche im Fuchsenfeldhof im Wiener Bezirk Meidling, die in der Arbeiterinnen-Zeitung gelobt wurde. Auch das Einküchenhaus wurde dort gepriesen, dieses Konzept konnte sich jedoch aus Kostengründen nicht durchsetzen.
innerhalb eines Mehrparteienhauses die Küchen der einzelnen Wohnungen ersetzte. Teilweise wurden diese Forderungen umgesetzt, wie etwa in Form einer Zentralwaschküche im Fuchsenfeldhof im Wiener Bezirk Meidling, die in der Arbeiterinnen-Zeitung gelobt wurde. Auch das Einküchenhaus wurde dort gepriesen, dieses Konzept konnte sich jedoch aus Kostengründen nicht durchsetzen.
Es zeigte sich, dass es durch die Elektrifizierung des Haushalts zwar zu einer Verringerung des Kraftaufwands kam, sich dies am Ende jedoch nicht auf die Arbeitszeit insgesamt auswirkte: Veränderte Ansprüche an die Sauberkeit und die Kinderbetreuung balancierten die durch „elektrische Unterstützung“ gewonnene Zeit wieder aus. Dadurch, dass die Tätigkeiten im Haushalt nun nicht mehr so körperlich schwer zu erledigen waren, wurden sie gar abgewertet: Das bisschen Haushalt konnte ja nun quasi nebenbei bewerkstelligt werden. Dieser Rückschluss war selbstverständlich nicht im Sinne der ersten feministischen Bewegung.
Auch die Werbung entsprach nicht dem Verständnis der Frauenbewegung: Damals wie heute transportiert Werbung Bilder und Werte, mit denen sich die Gesellschaft identifizieren und zum Kauf bewogen werden soll. Der äußerliche Schein der Werbeversprechen für Elektrohaushaltsgeräte wirkte zwar progressiv und modern, die transportierten Werte waren jedoch konservativ und traditionell. Frauen wurden zwar modern und selbstbewusst präsentiert, allerdings überwiegend in der Rolle der Mutter und Hausfrau, welche nun mehr Zeit für Ehemann und Nachwuchs hatte. Zu gleicher Zeit galten Frauen als technisch nicht versiert, sodass nicht nur die Frau „zur Modernität“ durch die Verwendung der Technik erzogen, sondern gleichermaßen der technikaffine Mann für die Relevanz des Produktkaufs für den Haushalt überzeugt werden musste.
Demgemäß wurde in der Bewerbung mit widersprüchlichen Bildern gespielt, in welchen die beworbenen Geräte als Symbole für Fortschritt und Entwicklung fungierten, über die allerdings der gesellschaftliche Platz der Frau weiterhin im Haushalt und bei der Familie gefestigt wurde. So unterstützten zwar, wie das Beispiel Wien zeigt, die Frauenbewegungen die Einführung der Elektrizität mit ihren Forderungen nach zentralen Waschküchen oder besser ausgestatteten Wohnungen, dabei führte die Werbeoffensive der Elektrounternehmen letzten Endes jedoch zur Verankerung des traditionellen Frauenbilds in Familie und Heim. (Katrin Brandstätter)
Warum ausgerechnet das Bügeleisen?
Das elektrische Bügeleisen war der Haushaltsgegenstand, der nach dem elektrischen Licht als erster in die Haushalte gelangte. 1929 veröffentlichte die Bewag (Berliner Städtische Elektrizitätswerke Aktien-Gesellschaft) die Ergebnisse einer Umfrage, bei welcher, laut eigenen Angaben, 90 Prozent der Berliner Haushalte mitwirkten. Diese Umfrage ergab, dass rund 55 Prozent der Haushalte einen elektrischen Anschluss hatten. Von diesen wiederum hatten 54 Prozent mindestens ein elektrisches Bügeleisen. Dabei spielte es in der Verteilung der elektrischen Bügeleisen kaum eine Rolle, ob der elektrifizierte Haushalt in einem ärmeren oder in einem wohlhabenderen Viertel Berlins angesiedelt war.
Für viele Frauen war die Wäsche ihr persönlicher Reichtum (was schon für die Aussteuer galt), den es besonders zu pflegen galt. Nicht nur im privaten Bereich waren die Wäsche und das Bügeln für Frauen von Bedeutung: Der Beruf als Wäscherin bot die Möglichkeit, Geld zu verdienen und somit eine gewisse Unabhängigkeit zu erlangen. Der Verdienst reichte oft sogar zur Alleinernährerin der Familie. Zudem konnte die Arbeit im eigenen Heim ausgeübt werden, egal ob im geräumigen Haus oder in einer kleinen Mietwohnung. Es bedurfte nur der nötigen Gerätschaften. Grundsätzlich konnte jede Frau den Beruf ausüben, der zudem gewisse Sympathie genoss: Darauf verweisen Stilisierungen junger Waschfrauen, welche fröhlich singend Wäschekörbe auf ihren Hüften balancieren.  Diese schweißtreibende Tätigkeit wurde nicht nur verklärt, sondern war bei den Männern auch angesehen: Zumindest in Dörfern galt eine versierte Wäscherin als besonders heiratsfähig.
Diese schweißtreibende Tätigkeit wurde nicht nur verklärt, sondern war bei den Männern auch angesehen: Zumindest in Dörfern galt eine versierte Wäscherin als besonders heiratsfähig.
Einen weiteren sozialen Aufstieg konnten Frauen erreichen, indem sie sich auf das Plätten spezialisierten und es professionell ausübten. Nicht nur Privathaushalte beschäftigten Plätterinnen, sondern auch die Wäscheindustrie, wo die Nachfrage nach gebügelter Wäsche stetig stieg. Obwohl hier auch Plättmaschinen zum Einsatz kamen, wurde wohl die Hälfte der Wäsche noch von Hand gebügelt. Um Platz auf Firmengrund zu sparen, wurden vermehrt Personen, meistens Frauen, angeheuert, die Wäsche zu Hause bügelten. 1914 waren allein in Groß-Berlin geschätzt 10 000 Menschen von zu Hause aus für die Wäscheindustrie tätig.
Die technische Errungenschaft des elektrischen Bügeleisens befeuerte die Attraktivität des Plätterinnenberufs. Prinzipiell notwendig für ein funktionierendes Bügeleisen ist eine Hitzequelle. Lange Zeit befand sich diese außerhalb des Bügeleisens: Entweder wurde das Eisen zum Erhitzen auf den Herd gestellt, oder es gab ein Bügeleisen mit Hohlraum für heiße Metallstangen – bei nur einer Stange dauert das Erhitzen allerdings lange. An der eigentlichen, plättenden Funktionsweise des Bügeleisens musste nichts verändert werden, die Neuerung bezog sich primär auf die Hitzequelle: Elektrizität sorgte für eine dauerhafte Wärmeversorgung. Sie führte zu Zeitersparnis beim Bügeln, das nun auch keine Rußflecken mehr auf der Wäsche hinterließ – eine potenziell negative Begleiterscheinung beim herkömmlichen Erhitzen auf dem Ofen. Im Vergleich zu den Spiritus- und Gasbügeleisen hatte das elektrisch betriebene den Vorteil, dass es keine Flamme benötigte und die Luftqualität nicht beeinflusste. Ideal bei dieser frühen elektrischen Bügelmethode: Es waren keine zusätzlichen Anschlüsse nötig, der Strom zum Bügeln konnte vom Deckenlicht entnommen werden. Also bot sich jedem Haushalt, der an das Stromnetz angeschlossen war, die Möglichkeit, auch ein elektrisches Bügeleisen zu nutzen. (Teresa Ó Dúill)
Abbildungen (von oben)
Das elektrische Licht, interpretiert vom Münchner Genremaler Ludwig Kandler. (Foto: Archiv)
Die Elektrizitätsausstellung 1882 wurde im Münchner Glaspalast eingerichtet. Besondere Aufmerksamkeit galt der Vorführung eines komplett elektrisch ausgestatteten Theaters. Die Abbildung zeigt – vom 600 Plätze umfassenden Publikumsraum aus gesehen – die Dekoration zur Abschlussfeier. Bei der Bühnenbeleuchtung (folgende Abbildung) stand die Regulierbarkeit der „Edison'schen Glühlichter“ im Fokus. Die Illustrationen stammen aus dem über 400-seitigen, reich bebilderten Abschlussbericht zur Ausstellung. (Fotos: Archiv)
Sensation bei der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt 1891 war die Energieübertragung über eine Distanz von 175 Kilometern. Im Bild die Mitte eines dreiteiligen, mit 1000 Glühlampen illuminierten Eingangstors zum Ausstellungsgelände. Folgende Abbildung: Die Schau besuchten rund 1,2 Millionen Menschen aus aller Welt. Eine Illustration im Familienblatt Die Gartenlaube (unten) gab den Eindruck der nächtlichen Beleuchtung wieder. (Fotos: Wikipedia, Die Gartenlaube, 1891)
Frauenrechtlerinnen sahen im Einküchenhaus die Möglichkeit, die individuelle Arbeit im Kleinhaushalt zu reduzieren – damit Frauen auch anderen, bezahlten Arbeiten nachgehen konnten. In den zentralen Küchen sollte eigens angestelltes Hauspersonal arbeiten. Doch nur vereinzelt konnten sich solche Modelle durchsetzen. Hier eine Ansicht aus einem Berliner Einküchenhaus. (Foto: SZ Photo)
Eine Frau beim Bügeln mit einem der ersten elektrischen Bügeleisen von AEG im Jahr 1912. Es konnte per Post bestellt werden. (Foto: dpa)












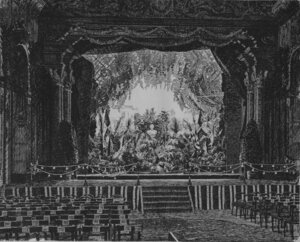













Kommentare (0)
Es sind noch keine Kommentare vorhanden!