Unser Alltag wäre ohne medizinische Forschung unvorstellbar. Auch die Ökonomie ist eine alltäglich spür- und erlebbare Wissenschaft. Mit der Philosophie verhält es sich anders. Sie erscheint eher wie eine schöne Tapete im nüchternen Haus der Fakten. Dabei berührt die Philosophie Essenziellstes: die Fragen nach dem Guten, Schönen und Wahren. Zum Welttag der Philosophie, der heuer auf den 20. November fällt, haben wir fünf Philosophen gefragt, was uns ihre Wissenschaft gerade heute geben könnte.
Rein in den öffentlichen Diskurs
 Mehr philosophische Weisheit im Diskurs wäre ein großer Wunsch von Paulus Kaufmann, Geschäftsführer des an der Ludwig-Maximilians-Universität München angesiedelten Zentrums für Ethik und Philosophie in der Praxis (ZEPP). Treffen heute zwei Menschen unterschiedlicher Gesinnung aufeinander, beginnen sie meist sofort, sich gegenseitig abzuwerten. Ist der Kontrahent endlich mundtot gemacht, stellt sich Genugtuung ein. Zu irgendeiner Art von Vereinbarung zu kommen, erscheint ausgeschlossen – eine fatale Entwicklung.
Mehr philosophische Weisheit im Diskurs wäre ein großer Wunsch von Paulus Kaufmann, Geschäftsführer des an der Ludwig-Maximilians-Universität München angesiedelten Zentrums für Ethik und Philosophie in der Praxis (ZEPP). Treffen heute zwei Menschen unterschiedlicher Gesinnung aufeinander, beginnen sie meist sofort, sich gegenseitig abzuwerten. Ist der Kontrahent endlich mundtot gemacht, stellt sich Genugtuung ein. Zu irgendeiner Art von Vereinbarung zu kommen, erscheint ausgeschlossen – eine fatale Entwicklung.
Die Einrichtung von Kaufmann, einem Experten für japanische Kultur und Philosophie, engagiert sich intensiv für den öffentlichen Diskurs. „Zwei Drittel unserer Veranstaltungen wenden sich an eine größere Öffentlichkeit“, sagt der Philosoph. Bei der nächsten Veranstaltung am 25. November wird etwa der Lüneburger Philosoph Heiko Stubenrauch die Frage erörtern: Warum tun wir nichts gegen die Klimakrise?
Dass Philosophie kaum noch eine Rolle spielt, erscheint allenfalls auf den ersten Blick so. Zumindest auf den zweiten Blick wimmelt es vor Philosophen. Wobei sich die wenigsten, abgesehen von Stars wie Richard David Precht, mit lauter Stimme äußern. Doch hinter den Kulissen tut sich eine Menge. Wie viel in Zeitungen und Zeitschriften, via Podcast oder online philosophisch publiziert wird, zeigt etwa die Plattform „PhilPublica“. Kaufmann verweist außerdem auf den Ethik-Podcast „hinterfragt“ des Instituts für Philosophie der Uni Bern. Dort kann aktuell eine Episode zum Thema „Wissenschaftsfreiheit“ heruntergeladen werden. Im Gespräch mit Tim Henning, Professor für praktische Philosophie an der Uni Mainz, wird die Frage erörtert, ob man Wissenschaftler für ihre Thesen moralisch kritisieren darf.
Raus aus der digitalen Einsamkeit
 Die Philosophie sei von ihrem Wesen her geeignet, einen „Gegen-Ort zu populistischen Phrasen“ zu kreieren. Das denkt Ute Möller, Philosophin aus Nürnberg. „Im philosophischen Denken können wir uns in Ruhe auf uns und unsere Rolle in der Gesellschaft besinnen“, erklärt sie. Im besten Fall findet man heraus, wie viel uns Menschen miteinander verbindet: „Wir haben allen Grund, uns zu mögen.“
Die Philosophie sei von ihrem Wesen her geeignet, einen „Gegen-Ort zu populistischen Phrasen“ zu kreieren. Das denkt Ute Möller, Philosophin aus Nürnberg. „Im philosophischen Denken können wir uns in Ruhe auf uns und unsere Rolle in der Gesellschaft besinnen“, erklärt sie. Im besten Fall findet man heraus, wie viel uns Menschen miteinander verbindet: „Wir haben allen Grund, uns zu mögen.“
Ja, warum mögen wir einander nicht mehr? Das Nachdenken hierüber führt zum antiken Philosophen Diogenes, der angeblich am helllichten Tag mit der Lampe in der Hand einen tugendhaften, sprich guten Menschen suchte. Für Philosophin Möller ist Philosophie mehr als ein Füllmittel für triste Novemberabende, an denen man nichts Besseres zu tun hat, als zu lesen. Früh inspiriert wurde sie vom amerikanischen Pragmatismus. John Dewey ist einer seiner Vertreter: „Er geht davon aus, dass wir nur dann etwas dazulernen, wenn wir eine Erfahrung gemacht haben.“
Mit „Erfahrung“ sei dabei jener Moment gemeint, in dem man etwas Neues erlebt, mit dem man nicht aus dem Stegreif umgehen kann. Wer eine solche Situation bewältigt, komme einen Schritt weiter.
Philosophisch gekonnt sind für Möller vor diesem Hintergrund auch die Texte von Byung-Chul Han. Der gebürtige Südkoreaner studierte in München Philosophie. „In seinem Buch Die Krise der Narration ruft er uns dazu auf, der lärmenden Leere wieder verbindende Erzählungen entgegenzusetzen“, sagt Ute Möller. Viele Menschen seien heute im digitalen Dauerfilm alleine: „Aber wir haben es in der Hand, auszubrechen und wieder miteinander ums Lagerfeuer zu sitzen und uns Geschichten zu erzählen.“
Auch das Gegenüber könnte im Recht sein
 Mit jungen Leuten aus anderen Ländern zusammenzusitzen, Geschichten zu erzählen, über das Leben nachzudenken: Das liebt auch Gudrun Schweisfurth. Sie betreibt in München eine philosophische Praxis. Außerdem unterrichtet sie an einer Berufsschule Ethik: „Und zwar für Metzgereifachverkäufer.“ Fast keiner dieser Berufsschüler kommt ursprünglich aus Deutschland: „In meiner Klasse sitzt die ganze Welt.“ Mit den jungen Menschen philosophiert sie über das Leben, kann mit ihnen lachen und weinen. „Viele vermissen ihr Heimatland, viele haben starkes Heimweh, viele schämen sich aber auch, weil sie nicht gut Deutsch sprechen können.“
Mit jungen Leuten aus anderen Ländern zusammenzusitzen, Geschichten zu erzählen, über das Leben nachzudenken: Das liebt auch Gudrun Schweisfurth. Sie betreibt in München eine philosophische Praxis. Außerdem unterrichtet sie an einer Berufsschule Ethik: „Und zwar für Metzgereifachverkäufer.“ Fast keiner dieser Berufsschüler kommt ursprünglich aus Deutschland: „In meiner Klasse sitzt die ganze Welt.“ Mit den jungen Menschen philosophiert sie über das Leben, kann mit ihnen lachen und weinen. „Viele vermissen ihr Heimatland, viele haben starkes Heimweh, viele schämen sich aber auch, weil sie nicht gut Deutsch sprechen können.“
Was sie in der Berufsschule während des Ethikunterrichts alles erlebt, fließt in ihr Dissertationsprojekt: Schweisfurth promoviert an der Münchner Hochschule für Philosophie gerade über die „Phänomenologie des Staunens“. Im Kern geht es auch für sie in der Philosophie um die Frage, wie wir Menschen gut miteinander leben können. Die Frage klingt simpel – „aber viele Philosophen haben in Bezug hierauf um Erkenntnis gerungen“.
Eben dieses Um-Erkenntnis-Ringen scheint inzwischen aus der Zeit gefallen zu sein. Man platzt mit dem heraus, was einem gerade durch den Kopf schießt – und hält das bereits für eine Erkenntnis. Doch so gelingt Erkenntnisgewinnung nicht: Schweisfurth verweist auf den Philosophen Theodor Adorno. Ihm zufolge sollte man sich immer vor Augen halten, dass das Gegenüber Recht haben könnte.
Philosophisches Denken trainieren
 Philosophie könne zu einem Perspektivenwechsel führen, bestätigt Moritz Hildt, Philosoph, Dozent und freier Schriftsteller aus Passau. Und sie führe zu der Einsicht, dass die Dinge komplizierter sind, als sie scheinen. Diese Erkenntnis spiegelt sich auch in den Romanen des 1985 im baden-württembergischen Schorndorf geborenen Autors. Zu denken, tiefgehend zu denken, das muss man genauso trainieren, wie man Körperkraft trainiert. Bei Hildt kann man das philosophische Denken lernen. Der Schriftsteller unterrichtet zum Beispiel an der Technischen Hochschule Deggendorf Philosophie. Mit Promovenden denkt er hier über Ethik in der Wissenschaft nach. Auch mit Offiziersanwärtern an der Universität der Bundeswehr erörtert der Schriftsteller philosophische Fragen.
Philosophie könne zu einem Perspektivenwechsel führen, bestätigt Moritz Hildt, Philosoph, Dozent und freier Schriftsteller aus Passau. Und sie führe zu der Einsicht, dass die Dinge komplizierter sind, als sie scheinen. Diese Erkenntnis spiegelt sich auch in den Romanen des 1985 im baden-württembergischen Schorndorf geborenen Autors. Zu denken, tiefgehend zu denken, das muss man genauso trainieren, wie man Körperkraft trainiert. Bei Hildt kann man das philosophische Denken lernen. Der Schriftsteller unterrichtet zum Beispiel an der Technischen Hochschule Deggendorf Philosophie. Mit Promovenden denkt er hier über Ethik in der Wissenschaft nach. Auch mit Offiziersanwärtern an der Universität der Bundeswehr erörtert der Schriftsteller philosophische Fragen.
Zu Beginn der ersten Flüchtlingswelle 2015 promovierte Hildt über die Herausforderungen des Pluralismus. „Philosophie muss nicht kompliziert sein“, sagt er. Gerade große Philosophen bestechen durch eingängige Lakonie. Man denke an Georg Christoph Lichtenberg und seinen lakonischen Weisheitsspruch: „Wenn alle das Gleiche denken, denkt keiner richtig.“
Europa muss auf die Philosophie hören
 Gerade in der heutigen Welt müsste Philosophie viel einflussreicher sein. Das findet Ruth Hagengruber, im niederbayerischen Regen geborene Philosophin, die heute in Paderborn forscht und als erste Frau an der Spitze der Deutschen Gesellschaft für Philosophie (DGPhil) steht. „Viele drängende Fragen warten auf die Philosophie“, sagt sie. Hagengruber denkt zum Beispiel an die Problematik mit der künstlichen Intelligenz: „Tut Europa gut daran, die Grenzen des Machbaren der künstlichen Intelligenz einzuschränken? Kann es damit sogar ein sicherer Hafen in der globalen Welt werden, oder wird ihr diese Politik zum Nachteil gereichen?“
Gerade in der heutigen Welt müsste Philosophie viel einflussreicher sein. Das findet Ruth Hagengruber, im niederbayerischen Regen geborene Philosophin, die heute in Paderborn forscht und als erste Frau an der Spitze der Deutschen Gesellschaft für Philosophie (DGPhil) steht. „Viele drängende Fragen warten auf die Philosophie“, sagt sie. Hagengruber denkt zum Beispiel an die Problematik mit der künstlichen Intelligenz: „Tut Europa gut daran, die Grenzen des Machbaren der künstlichen Intelligenz einzuschränken? Kann es damit sogar ein sicherer Hafen in der globalen Welt werden, oder wird ihr diese Politik zum Nachteil gereichen?“
Hagengruber verweist weiter darauf, dass unsere Vorstellungen von Menschenrechten das Ergebnis jahrhundertelanger philosophischer Debatten sind. Am 20. November veranstaltet die DGPhil einen Festakt zum Thema „Europa neu denken“, bei dem es auch um den Charakter der Menschenrechte geht. „Im Kampf der Hegemonialmächte werden die universellen Ideen, wie sie in der europäischen Philosophie geschaffen wurden, zum Beispiel Menschenrechte und Gleichheit, global infrage gestellt“, sagt sie. Mit Verweis auf den Schutz kultureller Eigenheiten würden sie, ablesbar an der weltweiten Unterdrückung der Frau, ad absurdum geführt. (Pat Christ)









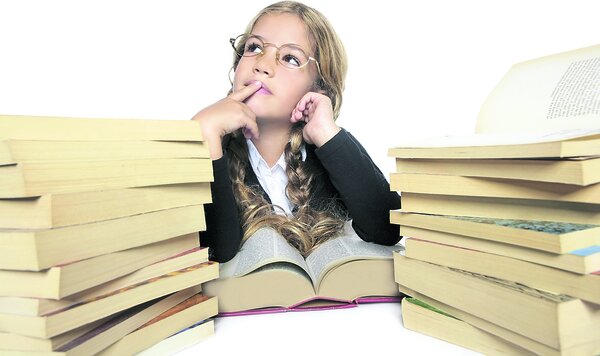












Kommentare (0)
Es sind noch keine Kommentare vorhanden!